Der Blog Spiele im Kopf veranstaltet den diesmonatigen Karneval der Rollenspiel-Blogs zum Thema "Ruinen".
Hierzu kamen bereits unzählige, tolle Spiematerialien zusammen. Ich möchte aber grundlegender über Ruinen sprechen.
Es kann heute eine große
Herausforderung sein, Ruinen als Szenario schmackhaft zu machen.
Schnell wird ihnen die Aura monotonen Räume Durchsuchens und
stupiden Monster Tothauens verliehen. Dabei bestätigen viele Spieler sich selbst lediglich ihre eigenen Vorurteile. Denn selbst in unserer Realität gehen Ruinen nicht nur buchstäblich in die Tiefe, sondern sind mit der Geschichte verwoben.
Vielleicht liegt die oberflächliche Handhabe daran, dass viele
von uns Ruinen - also verlassene und verfallene Bauwerke - nur als
Touristen oder von Urlaubsfotos oder aus Büchern kennenlernen.
Anderen stehen sie lediglich ihrem schicken Fertigteile-Neubau im
Weg. Und für D&D Rollenspieler sind sie meist der
Abenteuerspielplatz schlechthin. Deswegen sind Ruinen ein integraler
Bestandteil vieler klassischer Rollenspiele. Ich finde Ruinen
inspirierend, so wie ein Bild oder ein Lied.
Ruinen können für verschiedene
Personen also eine unterschiedliche Bedeutung haben und es lohnt sich
bei der Integrierung von Ruinen ins Rollenspiel (RPG) einen kurzen Blick darauf zu werfen. Denn genaugenommen steht die Ruine nur als
Schauplatz von Ereignissen im Fokus vieler RPGs. Die Ruine selbst wird meist vernachlässigt. Die RPG-Ereignisse,
die Abenteuer, die Monsterbegegnungen, die Fallen, Schatzsuchen usw.
die könnte man auch an jedem beliebigen anderen Ort unterbringen.
Etwas ist also am Wesen der Ruine an
sich, das fasziniert. Richtigerweise wird zwar argumentiert, dass man
in Ruinen nur eine eingeschränkte Bewegungs- und Interaktionsfreiheit mit der Spielwelt hat, die Spielrunde also einen
leichteren Umgang mit dem Spiel hat. Jedoch gilt das genaugenommen
speziell für den "Dungeon", also eine unterirdische
Anlage, die auch nicht zwingend als Ruine vorliegen muss.
Begibt man sich in eine Ruine, dann
bekommt man auch Hinweise auf die Nutzung und ihre einstigen Bewohner, den
Handwerkern, Baumeistern, Dienern oder Angestellten, die an diesen Orten
gewirkt haben. Je nach Anordnung der Anlage gibt die Ruine dabei
nicht einfach nur Eindrücke, wo jemand irgendwo mal irgendetwas
gemacht hat, sondern wo exakt jemand etwas ganz Bestimmtes an einem
bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit getan hat. Jemand, der
keine andere Möglichkeit mehr hat, von sich zu erzählen, dessen
Erfahrung aber im Zustand der Ruine nachwirkt und in die wir uns hineinversetzen können.
Dieser vollumfängliche Sinneseindruck
lässt sich auch anhand von (Kunst-)Handwerksstücken, z.b. ein Buch
oder ein Gedicht, nur eingeschränkt nachempfinden, da ihnen ja die
räumliche Zuordnung fehlt.
Die Ruine erzählt also etwas von den
Menschen nachdem diese die Bühne verlassen haben, durch ihre einstige Errichtung und Nutzung, aber genauso
über die Menschen, nämlich durch ihren Verfall und ihren
Zustand. Und je älter die Ruine ist und desto weniger Primärquellen
vorliegen, je mehr Zeit also überbrückt wird, desto unmittelbarer
kann die Erfahrung und die Verbindung zu seinen Bewohnern oder
Erbauern sein. Die Ruine bekommt einen Wert an sich, der mit dem Alter steigt.
Und dieser Wert und der vielfältige Umgang mit der
Ruine an sich kann eine große Bereicherung (nicht nur) für ein
Rollenspielsetting sein.
Dabei wird schnell vergessen, dass es
Ruinen zu allen Zeiten der Geschichte gegeben hat. Der Bestandsschutz
von Ruinen als Denkmal ist wohl eine relativ moderne Erscheinung, das
heißt, der praktische Nutzen von Ruinen, z.B. als Steinbruch zur
Materialgewinnung, war davor von größerer Bedeutung. So finden sich
gerade viele Burganlagen als Trockenmauern am Feldrand oder in
Behausungen der unmittelbaren Umgebung wieder. Vielfach wurden
Anlagenreste in neue Bauten integriert und weiter genutzt.
Das heißt aber nicht, dass die Ruinen
keinen Eindruck bei unseren Vorfahren hinterlassen haben und zwar
Eindrücke und Erfahrungen, die uns heute verwehrt bleiben.
Als erstes Beispiel sei das
frühmittelalterliche Rom genannt. Welche Vorstellungen müssen die
gerade noch 20.000 Einwohner Roms gehabt haben, umgeben von Ruinen
und pompöser Architektur, täglich erinnert zu werden, in einer
einstigen Millionenstadt zu leben, deren höher entwickelter Stand
bereits sieben Jahrhunderte zurückliegt und den sie erst im 20.
Jahrhundert wieder erreichen sollte? Eine quasi postapokalyptische
Atmosphäre, die überall im ehemaligen Weströmischen Reich zu
spüren gewesen sein muss. Ein eindrücklicher Hinweis darauf ist
vielleicht die berühmte, altenglische Elegie "Die Ruine"
(http://faculty.arts.ubc.ca/sechard/oeruin.htm), in die der unbekannte Autor den Reichtum und Fortschritt einer seit
langer Zeit in Ruinen liegenden Stadt bedauert.
Ein anderes, prominentes Beispiel
im Umgang mit Ruinen findet sich zur Zeit der Aufklärung. Diese war Mitte des 18. Jahrhunderts im vollen Gange und
es formierten sich Bewegungen, um der "Vernunft" etwas
entgegenzusetzen oder sie zumindest kritisch zu reflektieren und man
wandte sich wieder in emotionale, instinkthafte und irrationale
Richtungen. Wieder dienten einigen Künstlern die Ruinen als
eindrückliche Steilvorlage. Maler wie Piranesi oder Hubert Robert
griffen Elemente der Antike und des Mittelalters auf, wie die Klassik
und die Gotik, inszenierten und überhöhten sie auf phantastische Weise, oder entwickelten
sie weiter.
 |
| Giovanni Battista Piranesi (Italy, Mogliano, 1720-1778),Part of a spacious and magnificent Harbor for the use of the ancient Romans opening onto a large market square. Source: Wikimedia Commons |
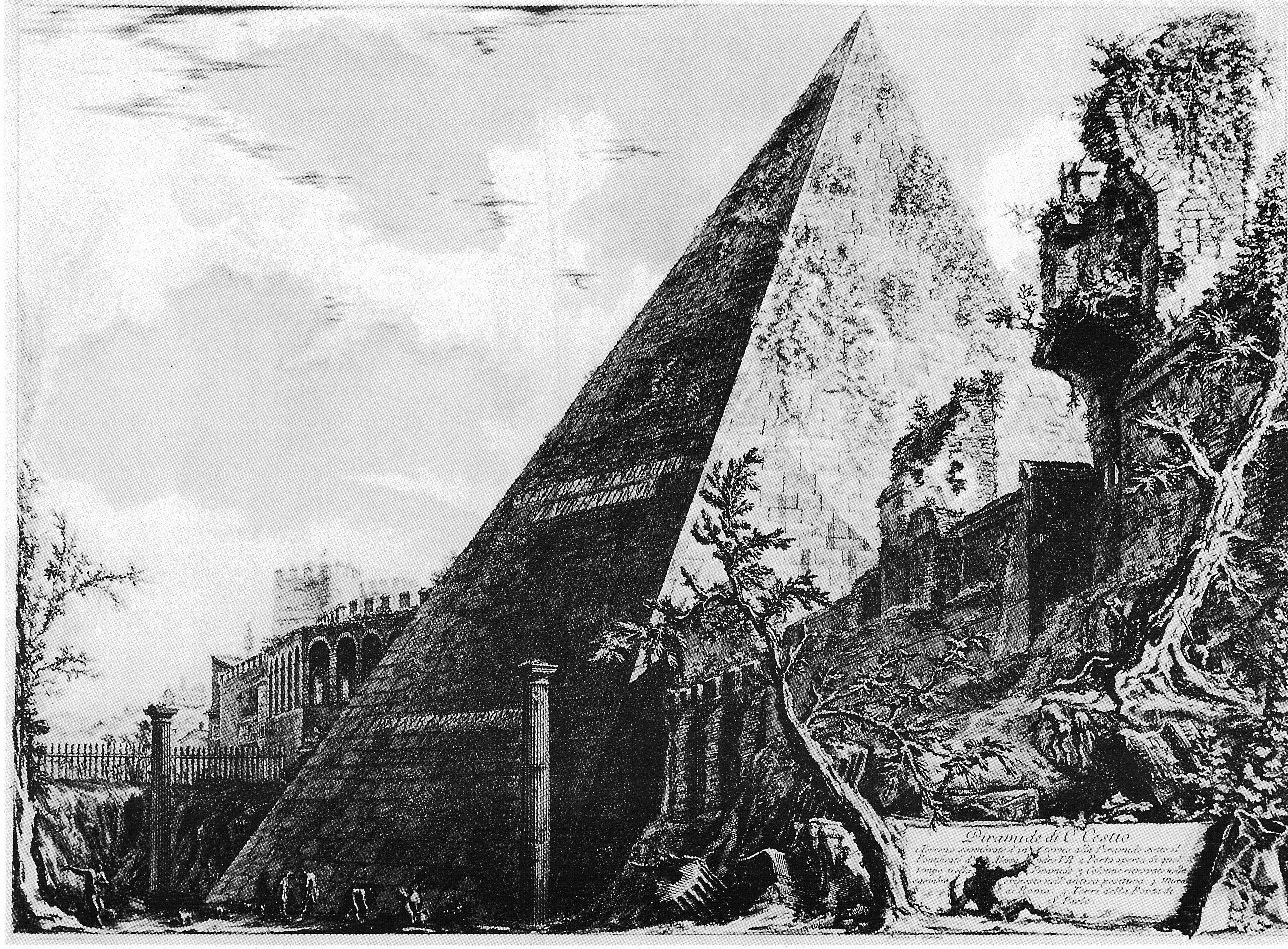 |
| Giovanni Battista Piranesi (Italy, Mogliano, 1720-1778), Etching of the Pyramid of Cestius in Rome. Source: Wikimedia Commons |
Schaut man sich ihre Bilder und die anderer Zeitgenossen
an, dann findet man die bekannten, labyrinthartigen Strukturen,
endlose Gewölbe und Geheimgänge und entdeckt darin unscheinbare,
staunende Gestalten, die ziellos umherirren, unfähig, die höheren
Mächte zu begreifen, die all dies errichteten und wieder zu Fall
brachten.
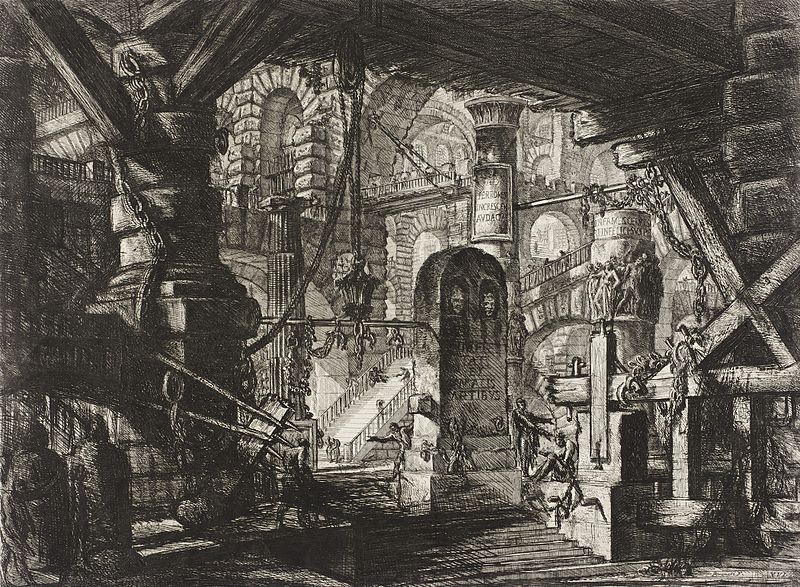 |
| Giovanni Battista Piranesi (Italy, Mogliano, 1720-1778), The Pier with Chains.
Source: Wikimedia Commons
|
Dabei wird die Hybris jener vergangener Zivilisationen und
ihrer Erbauer offengelegt, oder auch der Größenwahn zeitgenössischer Herrscher angedeutet.
 |
| Hubert Robert (1733-1808), Imaginary View of the Grand Gallery of the Louvre in Ruins Source: Wikimedia Commons |
All dies fand schließlich Eingang in
das sich erst entwickelnde Horror- und Science-Fiction-Genre bis hin
zum modernen Pulp und Fantasy, aus denen RPG bis heute zehrt. Was
nichts anderes heißt, als dass Ruinen auch heute keine
Selbstverständlichkeit sind, die einfach nur die Landschaft
verzieren, sondern dass der ganze Umgang mit ihnen eine Grundlage und
selbst eine Geschichte hat, die wir im RPG als Hobby weiterführen können, anstatt ihnen einfach einen Hack'n Slay Stempel
aufzudrücken. Im Old School D&D Bereich werden diese Konzepte aufgegriffen und diskutiert, z. B. den Dungeon als mystische Unterwelt, natürlich um ihn zu rechtfertigen, aber vor allem um Interpretationsmöglichkeiten zu erschließen.
In diesem Sinne können Ruinen selbst auch eine Spielrunde bereichern. Dies muss nicht allzu verkopft sein und soll Spaß machen, denn die Spielercharaktere haben etwas zu
entdecken und zusammenzufügen, was spieltaktische Vorteile bringen
kann oder es werden Fragen und Details aufgeworfen, auf die es
möglicherweise keine Antworten gibt oder deren Bedeutung verloren
ist, was der Spielwelt Tiefe verleiht.
Ich versuche das in einer eigenen
RPG-Kampagne auszunutzen und überhaupt jedem Dungeon und jeder Ruine eine Geschichte zu geben. Als stimmungsgebende Atmosphäre in dieser
spätantiken Fantasywelt blicken die Bewohner auf eine kulturell
höher entwickelte, verlorene Vergangenheit zurück, da ihre Gegenwart in Ruinen
liegt und die Zukunft noch unsicher ist, während ganze Völker
ziellos umherziehen. Mit jedem Stein, den die Spieler umdrehen,
erzählt die Welt damit auch etwas von sich und zwar andere Dinge,
als man in einem Tavernentratsch abhandeln kann. Man muss nur
zuhören.

